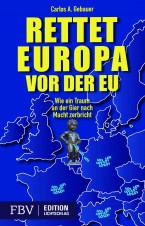Von der Unmöglichkeit, nicht definierte europäische
Werte souverän zu wahren – oder gar zu verteidigen
Vortrag von Carlos A. Gebauer am 12. Februar 2016
vor Wirtschaftsvertretern in Niederösterreich
I.) Einleitung
Warum können wir uns vorstellen, daß Woody Allen in einer New Yorker U-Bahn von Rockern verprügelt wird? Und warum ist John Wayne genau das nie passiert?
Selbstbewußtsein und Selbstbehauptung eines Menschen stehen miteinander in einer engen Verbindung. Nur wer an sich selber glaubt, hat überhaupt erst eine Aussicht auf die Möglichkeit, daß auch andere an ihn glauben. Dieser spezifische Zusammenhang besteht nicht nur bei einzelnen Personen, sondern auch bei Gruppen von Menschen. Gegen den FC Bayern oder den CF Barcelona können allenfalls solche Fußballmannschaften gewinnen, die ohne Angststarre in das Spiel gehen. Nur wer selbst daran glaubt, besser sein zu können als der andere, der kann auch gewinnen – notfalls in der Verlängerung. Entscheidend ist, welches Bild die Betreffenden von sich selber haben. Denn genau dieses Bild lebt man und zeigt man der Welt.
Gesetzt, diese grundsätzlichen Überlegungen sind richtig: Warum sollte für Europa insgesamt etwas anderes gelten? Vielleicht muß dieses Europa (was immer es überhaupt sei) weniger Angst vor „Überfremdung“ haben, wenn es sich vorab einmal für sich selbst interessiert – und also dafür, was es in der Welt sein will. In diesem Falle könnte jeder einzelne Europäer am Ende auch dafür zu gewinnen sein, nicht nur negativ gegen eine Islamisierung, sondern im Gegenteil konstruktiv und positiv für eine Europäisierung des Abendlandes einzustehen.
II.) Hauptteil
1.) Die Frage nach einem europäischen Selbstbewußtsein
a.) Eine erste terminologische Vorüberlegung: Was ist Selbst-be-wußt-sein?
Von einem „Selbstbewußtsein“ zu sprechen bedeutet, vier gedankliche Aspekte zu erfassen: (1) Das „Sein“ – als Substantiv – deutet auf eine bestehende Existenz. Etwas ist. (2) Mit dem Wortbestandteil vom Wissen („…wußt…“) wird ein denkendes Subjekt angesprochen: Irgendjemand weiß etwas. (3) Das Morphem „…be…“ kündet von der Passivität dessen, von dem etwas gewußt wird: Ebenso, wie einer besonnt wird oder beschallt, wie er berühmt ist oder begnadet, besessen, beseelt oder belächelt; er steht im Lichte eines fremden Wissens. (4) Schließlich sagt das „Selbst“ in „Selbstbewußtsein“, daß irgendjemand etwas von dieser Existenz eines anderen weiß; und dieser andere ist eben rückbezüglich das eigene Selbst. Anders gesagt: Wenn ich mir meiner selbst bewußt sein will, dann geht das nur, wenn ich für einen Augenblick aus mir heraustrete und mich selbst betrachte. Dann weiß ich von mir. Von mir selbst.
b.) Auf der Suche nach einem kollektiven Selbst
Eine völlig andere Qualität von „Selbstbewußtsein“ ist angesprochen, wenn ich nicht von einem einzelnen Individuum spreche, sondern von einer Mehrzahl von Menschen. Denn ein Kollektiv von Menschen verfügt nicht über ein „Selbst“ wie ein konkreter einzelner Mensch. Eine menschliche Gesellschaft kann keinen Kopf- oder Magenschmerz haben, weil sie weder über einen Kopf noch über einen Magen verfügt. Eine Menschenmenge ist kein konkretes Subjekt! In den Worten von Margaret Thatcher: “There is no such thing as society.” Das heißt: In der objektiven, äußeren Welt gibt es keine Gesellschaften. Es gibt nur einzelne Menschen. Gesellschaften entstehen nicht in der realen, objektiven Außenwelt, sondern im Auge und Kopf des Betrachters. Gesellschaften sind immer nur subjektive gedankliche Abstraktionen desjenigen, der über sie spricht. Verschiedene Betrachter können daher beim Betrachten ein und derselben Ansammlung von Männern gleichzeitig völlig andere Gesellschaften sehen: Einen Männerclub, einen Raucherclub oder eine Skatrunde. Den Mitgliedern einer solchen Gesellschaft geht es dabei nicht anders. Jeder konkrete einzelne macht sich unter Umständen völlig unterschiedliche Vorstellungen darüber, welcher Gruppe er angehört, weil jeder einzelne die Gemeinschaft, in der er sich befindet, subjektiv anders deutet.
c.) Gemeinsame Narrative als Vergewisserung für ein kollektives Selbst
Um sich ihrer selbst als Gemeinschaft zu vergewissern, tauschen die Angehörigen einer Gesellschaft sich über ihr jeweiliges Selbstverständnis als Gruppe aus. Die Individuen definieren, was jeder zusammen mit den anderen darstellen möchte. Der eigene Beitrag zum Ganzen und die Erwartungshaltung anderen gegenüber werden ausgesprochen. Bürgerliche Gesellschaften z.B. definieren dazu in einem Gesellschaftsvertrag ihren gemeinsam verfolgten Gesellschaftszweck und sie bestimmen, welches Individuum welchen konkreten Beitrag zum Ganzen zu leisten hat. Das erscheint in übersehbaren Gruppen noch vergleichsweise simpel.
Schwieriger gestaltet sich die Lage, wenn die Mitgliedschaft einer Gesellschaft so viele Köpfe umfasst, daß sie einander nie auch nur persönlich treffen können. In solchen Gesellschaften, etwa zur Konstituierung eines Staates aus einer Menschenmasse, ersetzen Erzählungen über das gemeinsame Herkommen, über den gemeinschaftlich bewohnten Landstrich oder über Staatsziele die verbindende Zweckbestimmung und Selbstdefinition aller. Dieses (heute gerne so bezeichnete) „Narrativ“ konstituiert dann ein gewisses gemeinsames Selbst und also die Bedingung der Möglichkeit von gesellschaftlichem Selbstbewußtsein.
2.) Die Frage nach einem gemeinsamen europäischen Narrativ
Gibt es aber ein solches gemeinsames europäisches Narrativ, ähnlich der Nibelungensage oder dem Rütlischwur, das allen Europäern die Chance zu einer kollektiven Selbstfindung, zu einer überindividuellen Identifikation spenden kann? Kann es ein verbindendes Moment geben, das für (nahezu) alle Menschen, die sich körperlich in Europa aufhalten, Gemeinschaft stiftend verbindlich ist? Oder wird der französische Napoleon immer ein anderer sein als der englische, deutsche oder polnische Napoleon?
a.) Was überhaupt ist auf Dauer Europa, was europäisch?
Wie hat man Europa (und das Europäische) überhaupt zutreffend zu definieren? Augenscheinlich weiß das niemand so genau. Geographisch? Historisch? Ökonomisch? Weltanschaulich? Religiös? Rechtlich? Wertorientiert? Politisch gar, mit der EU? Alles das scheint gut vertretbar, das jeweilige Gegenteil allerdings auch.
b.) Welche kulturellen Narrative dominieren aktuell?
Jenseits der definierenden Grenzziehungen schwirren die buntesten Narrative über unseren Kontinent. Der Ökologismus, in allen Spielarten von Bodenschutz bis Klimaschutz. Ein allgegenwärtiger Konsumismus. Nihilismus und Pessimismus. Demokratismus. Bürokratismus. Multikulturalismus. Antirassismus. Emanzipatismus. Wohlfahrtsstaatlicher Umverteilungs-Infantilismus. Bequemer Komfortismus etc. pp.
c.) Eine Vakuum-Hypothese: Es gibt kein allgemeingültiges Narrativ der Europäer
Die Europäische Union (als eine von vielen Möglichkeiten, „Europa“ zu verstehen) sagt von sich selbst, sie sei ein Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts. Mißt man diese Ideale an den Realitäten, könnten Zweifel aufkommen. Unkontrolliert-ungebändigte Masseneinwanderung schafft keine Sicherheit. Die Freiheit in einer das Internet zensierenden und das Bargeld abschaffenden Gesellschaft erscheint, milde gesagt, limitiert. Das Recht erfährt abnehmende Beachtung, wenn das Primat der Politik vordringlich blanken Funktionalismen folgt. Was also bleibt?
Lange Jahrzehnte waren Europa und die Europäische Union Hoffnung spendende Synonyme für den Frieden. Herrscht aber (noch) Friede zwischen Mitgliedstaaten, wenn sie einander mit Kommissaren überwachen, sich unter Kuratel stellen, einander Bedingungen stellen und in Kategorien wechselseitiger Schuldzuweisungen agieren?
Und: Selbst wenn man konstatiert, daß alle Mitgliedstaaten der Union nicht in offen gewaltsame Konflikte miteinander verstrickt sind: Herrscht Friede der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten gegenüber dem Außen? Oder sind nicht vielmehr schon offene Konflikte Teil des europäischen Alltagshandelns geworden, in Afghanistan, in Mali, in Syrien, um einige zu nennen?
d.) Ist innerer Friede ein Exportgut?
Selbst wenn man annähme, in der Europäischen Union herrsche interner Friede und selbst wenn man weiter annähme, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten stünden nicht in unfriedlichen Konflikten mit Dritten außerhalb, dann bliebe zu fragen: Läßt sich innere Friedlichkeit exportieren in eine unfriedliche Welt? In eine Welt, die mindestens außerhalb Europas unübersehbar miteinander in unfriedlichen Verhältnissen steht? Welches wären die Voraussetzungen, um einen solchen Friedlichkeitsexport mit Aussicht auf Erfolg durchzuführen?
3.) Ein desillusionierendes Zwischenresümee
Wenn es kein allgemeinverbindliches, weil allgemein für richtig und zutreffend gehaltenes Narrativ für alle Europäer gibt, dann mangelt es wohl an genau demjenigen Selbstbewußtsein, dessen es bedürfte, um anderen außerhalb Europas Kunde von der Überzeugungskraft der auf diesem Landstrich für richtig gehaltenen, gemeinsamen Selbstbetrachtung zu geben. Und wer nicht einmal an sich selbst glaubt, der kann – wie eingangs schon festgestellt – andere denknotwendig nicht dafür begeistern, diesen Glauben zu teilen. Aktuell finden sich auf Deutschlands Straßen Demonstranten unter Plakaten zusammen, auf denen es heißt „Liebe Ausländer, lasst uns mit diesen Deutschen nicht allein!“ oder „Deutschland, Du mieses Stück Scheiße“. Anders gesagt: Die Begeisterung eines Außenstehenden für eine solche Gesellschaft, die der unseren gleicht, ist in diesem Kontext wohl eher unmöglich.
4.) Konsequenzen und Ableitungen
In der gegenwärtigen „Flüchtlingskrise“ (die ungeachtet ihrer Bezeichnung neben eigentlichen Flüchtlingen im klassischen Sinne offenbar auch vielerlei Migranten unterschiedlichster Subkategorien zum hoffnungsvollen Aufbrechen in ein anderes Leben motiviert) droht nicht nur der Friedensexport zu scheitern, sondern im Gegenteil sogar ein Konfliktimport verwirklicht zu werden.
[Am Rande, sozialstaatlich bemerkt: Der wenig kluge Begriff vom „Wirtschaftsflüchtling“ – zum Unterschied von einem ‚wirklichen‘ politischen Flüchtling – enthält einen bitteren Beigeschmack: Kann man, unter normalen Umständen, vor der Wirtschaft fliehen? Man kann, wie jeder Glücksritter, besseren Lebensumstände erwarten, im Idealfalle bessere Arbeitsbedingungen für einen größeren persönlichen Wohlstand. Doch wer vor Wirtschaft flieht, den zieht es in einen Wohlfahrtsstaat; schade für dessen ökonomisch ausbalancierten Bestand…]
Die Staaten auf dem Territorium Europas sehen sich derzeit nach Monaten der unbeschränkten Einreisemöglichkeiten für jedermann vor einem Zwei-Fronten-Konflikt mit variierenden Kulturen: Nicht nur an den Außengrenzen der Länder droht Ungemach, sondern insbesondere auch im Inneren der europäischen Staaten. Den (in den Augen von Sicherheitsexperten) schier endlos einströmenden Mengen und Massen junger waffenfähiger Männer von überall stehen die (in den Augen der Sozialpolitiker) begrenzen Humankapitale Europas mit ihren eingefallenen demographischen Pyramiden gegenüber. Fast will scheinen, als verwirklichten sich vor unseren Augen die düsteren Prognosen über den „Youth Bulge“, also die Warnung vor demographisch gegenläufig konturierten Gesellschaften, deren junge Männer sich im Verteilungskampf um Lebensaussichten benachteiligt sehen und ihr Aktivitäts- und Aggressionspotential zum Ressourcenerwerb nun gegen die aus ihrer Sicht teilungsunwilligen Besitzenden zum Einsatz bringen.
Gesetzt den Fall, wir müßten annehmen, daß Europa in der Tat nicht positiv definiert werden kann, sondern – worauf zurückzukommen sein wird – nur negativ, dann wäre vielleicht mindestens übergangsweise zielführend, die Fahndung nach dem gesuchten Narrativ einer Eigendefinition vorläufig in einer Negativabgrenzung nach außen zu verorten. Anders gesagt: Findet sich Europa vielleicht dadurch, daß es erst einmal klarstellend verneinend sagt, was es jedenfalls nicht ist, statt gleich bejahend zu sagen, was es ist? Ein geschichtlicher Exkurs mag Licht in die mögliche Fruchtbarkeit dieser Arbeitshypothese bringen.
5.) Geschichtlicher Inkurs: Wo steht Europa?
Ein Blick auf die Landkarte rund um das Mittelmeer und eine Vergegenwärtigung der historischen Entwicklungen ebendort läßt tatsächlich etwas erkennen, was manche Tagespolitik aus dem Blick verloren zu haben scheint. Der uns eben noch – bis zum Jahr 1990 – so übermächtig präsente Ost-West-Gegensatz der großen politischen Blöcke stellt sich im größeren Kontext der Betrachtung geradezu nur als eine kurze Episode der geographisch näheren Konfliktgeschichte dar. Anders gesagt: Die tatsächlich existentiellen Kampflinien verlaufen seit mindestens anderthalbtausend Jahren völlig anders. Betrachtet man in möglichster Kürze die Entwicklung der Machtverhältnisse rund um das Mittelmeer, gewinnt man recht bald gewichtige andere Perspektiven.
Im Jahr 570 wurde der Prophet Mohammed in Mekka geboren. Bis zu seinem Tod in Medina anno 632 änderte er die Machtverhältnisse auf der arabischen Halbinsel. In der Folge blieb rund um das Mittelmeer nichts, wie es gewesen war. Im Jahr 610 hatte er sich als der Prophet Allahs erkannt, 613 seine Mission begonnen und sich 620 mit Mitstreitern daran gemacht, die arabische Halbinsel zu erobern. Als er starb, war dieses Werk bereits gelungen. Seine Nachfolger [die in Gestalt entzweiter Sunniten und Schiiten zugleich bis heute vielgestaltig heftig um das wahre Erbe des Propheten und seiner wohl einzigen leiblichen Tochter ringen] eroberten bis 638 dann die Gebiete des heutigen Irak, Syriens und Palästinas, bis 642 Ägypten, 651 weitgehend den Iran, 654 Rhodos, sie teilten 688 Zypern und zogen bis 698 westwärts quer durch Nordafrika. Im Jahr 700 war der Mittelmeerraum faktisch dreigeteilt in eine weströmische, eine oströmische und eine islamisch beherrschte Einflußsphäre.
Der anschließende Eroberungsfeldzug des Islam gen Norden erfolgte auf breiter Front; im Osten, im Westen und in der Zentralregion des Mittelmeers: 717/718 belagerten arabische Kämpfer im Osten – noch – erfolglos Konstantinopel, das heutige Istanbul und mithin die seinerzeitige Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. 719 eroberten sie hingegen im Westen ungebremst erfolgreich fast das gesamte heutige Spanien nebst Portugal, zogen 720 nordwärts bis Narbonne und konnten (nach vorherrschend geltender Geschichtsschreibung) erst 732 in der Schlacht bei Tours von dem Franken Karl Martell zurückgeschlagen werden. Das heutige Frankreich blieb demgemäß christlich. 878 jedoch wurde im Süden Syrakus und mit dem Fall von Taormina 902 schließlich ganz Sizilien arabisch bzw. islamisch.
Eine Gegenbewegung hierzu setzte erst im Jahre 961 wieder ein, als die Byzantiner zunächst Kreta und 965 dann Zypern für das christliche römische Reich zurückeroberten. Bis zur vollständigen Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch den christlichen Norden vergingen indes noch mehr als 500 Jahre: Die sogenannte Reconquista erlangte in Spanien erst im Jahre 1492 wieder die Macht für das Christentum. Wer Granada besucht, erhält diesen Kampf durch die Betrachtung einerseits der Alhambra und andererseits des nebenstehenden Palastes von Kaiser Karl bis heute eindrücklich vor Augen geführt.
Anders als Rom, das inmitten Italiens noch sicher vor arabischen Angriffen gelegen war, standen Konstantinopel und mithin das gesamte Byzantinische Reich spätestens seit 717 stets unmittelbar an der Grenze dem expansionsgeneigten Islam gegenüber. Nicht ohne Grund wird Byzanz heute als ein wesentlicher – wenn nicht der wesentliche – Faktor dafür angesehen, daß der Mittelmeerraum bis heute (noch) nicht insgesamt islamisch geworden ist. Byzanz war im Kern eine Melange aus römischer Verwaltung, griechischer Kultur und christlichem Glauben. Diese Elemente verliehen dem Byzantinischen Reich eine beachtliche Bestandsdauer von 393 bis 1453. Nicht ohne Grund wird diese Zeitspanne herangezogen, um das gesamte Mittelalter zeitlich zu definieren.
Zur Erinnerung ein Rückblick: Die sogenannte Reichsteilung Roms in eine weströmische und eine oströmische Hälfte erfolgte im Jahre 395, weniger um das Ganze zu zerteilen, sondern mehr, um schlankere und handlungsfähigere Strukturen zur Erhaltung des schwächelnden Gesamtreiches herbeizuführen. Während die ewige Stadt Rom die Hauptstadt des weströmischen Teiles blieb, stieg Konstantinopel zur Hauptstadt des oströmischen Reiches auf. Das vormalige exilgriechische Byzantion (oder lateinisch: Byzantium) war zu Ehren des Kaisers Konstantin des Großen (270 – 337) umbenannt worden. Denn mit seiner „konstantinischen Wende“ hatte er das Christentum zur führenden Religion in Rom gemacht. Indem Christen seitdem die „Staatsreligion“ stellten, sahen sie sich übrigens vor dem Problem, eine Theorie zum legitimen Gebrauch von Waffen im Krieg zu entwickeln. Dies besorgte der im Jahre 430 gestorbene „Kirchenvater“ Augustinus mit seinem Konstrukt vom „gerechten Krieg“: Nach dieser Darstellung gilt derjenige Krieg als gerechtfertigt und gerecht, der einen Frieden herbeiführt.
Der im Jahre 395 abgetrennte Westteil des römischen Reiches war dennoch schließlich im Jahre 476 nicht mehr gegen die germanischen, gotischen und alemannischen Angriffe aus dem Norden zu halten. An die Stelle des letzten autochthonen Kaisers Romulus Augustulus trat der eingewandert assimilierte Germane („Flavius“) Odoaker, der sich jedoch sogleich dem oströmischen Kaiser unterstellte. Unter der Führung Konstantinopels erlebte das Römische Reich daraufhin noch einmal eine erhebliche Blüte. Verlorene weströmische Provinzen wurden zurückerobert, zwischen 528 und 534 kodifizierte Kaiser Justinian (527 – 565) den Corpus Iuris Civilis – eine Rechtsquelle, die bis heute in Europa juristisch erheblich nachwirkt! – und 537 ließ er den Rohbau der Hagia Sophia fertigstellen.
572 indes begann für Byzanz der Krieg im Osten gegen die Perser. Bis 650 schrumpfte das Byzantinische Reich infolge seiner zusätzlichen Konflikte im Nordwesten mit Slawen und Bulgaren und mit den arabischen Eroberern im Süden erheblich. Die dadurch erzwungene Reduzierung ihres Territoriums nutzen die Byzantiner gleichwohl zur internen Neuorganisation. Genau diese half ihnen dann im Schicksalsjahr 717/718, dem von Süden geführten Angriff der Araber auf ihre Hauptstadt – wie schon ausgeführt – erfolgreich zu trotzen. Entscheidender für die zumindest vorläufig nachhaltige Befriedung ihrer Grenzen zur arabischen Einflußsphäre hin war jedoch noch die Schlacht bei Akroinon 740, die den Byzantinern dann auf längere Zeit Sicherheit vor der islamischen Expansion brachte.
Erst mehr als dreihundert Jahre und viele territoriale Erweiterungen später, im Jahre 1071, erfuhr Byzanz erstmals wieder eine empfindliche militärische Schwächung seiner Position. Bei der Schlacht von Manzikert im Osten des Byzantinischen Reiches siegten die Seldschuken, mithin dasjenige Volk, das weitere zweihundert Jahre später, 1299, als Osmanisches Reich auf die Bühne der Weltmächte treten sollte. Wesentlich an dieser Niederlage war nicht nur, daß sich die Seldschuken (alias Osmanen, alias Türken) an der byzantinischen Ostgrenze der Verbreitung des Islam verpflichtet sahen. Noch folgenreicher war, daß diese verlorene Schlacht praktisch unmittelbar in den Ersten Kreuzzug 1095 bis 1099 mündete.
Papst Urban II. ließ sich nämlich von Byzantinern überzeugen, daß das Römische Reich insgesamt durch die islamischen Seldschuken und ihren Sieg gegen Byzanz gefährdet sei, weswegen er die christlichen Pilger Europas aufrief, sich zu bewaffnen und mit diesem Ersten Kreuzzug Byzanz zu Hilfe zu kommen. Urban II. war bei dieser Gelegenheit zugleich erfreut, daß er und nicht sein Gegenpapst Clemens III. (1084 bis 1100) von den Byzantinern um Hilfe ersucht wurde. Dies stärkte seine eigene Stellung als der wahre Papst. Ziel dieses Kreuzzuges sollte sein, Palästina zu erobern, was mit der Eroberung Jerusalems auch gelang. Der „gerechte Krieg“, den Augustinus 600 Jahre zuvor theologisch beschrieben hatte, wurde nun von den Kreuzrittern zur sogenannten Heidenabwehr instrumentalisiert.
Infolge des Ersten Kreuzzuges wurden rund um Jerusalem vier Kreuzfahrerstaaten gegründet. Das Königreich Jerusalem umfasste ungefähr das heutige Israel, das Fürstentum Antiochia den Nordlibanon, die Grafschaft Edessa das heutige Syrien und die Grafschaft Tripolis den Süd-Libanon. Um diese Staaten in ihrer Frontlage gegenüber den arabischen Mächten zu stützen, wurde 1147 bis 1149 der Zweite Kreuzzug durchgeführt, der allerdings ohne irgendeinen greifbaren Erfolg blieb. Im Gegenteil. 1187 eroberte der islamische Führer Saladin seinerseits dann sogar Jerusalem.
Ein Grund für die Schwäche des Zweiten Kreuzzuges im Osten mag gewesen sein, daß Papst Eugen III. schon 1146 vorsorglich allen potentiellen Kämpfern in Spanien gestattet hatte, nicht nach Palästina zu gehen, sondern im Westen die iberische Halbinsel gegen die dort ebenfalls expandierenden islamischen Mauren aus Nordafrika (Berber) zu halten.
Die Eroberung Jerusalems durch Saladin 1187 rief dann den Dritten Kreuzzug von 1189 bis 1192 hervor, der sozusagen mit einem Unentschieden endete. Auch dieses Patt allerdings sollte wieder nicht von Dauer sein. Papst Innozenz III. rief 1198 zum Vierten Kreuzzug auf, der im Oktober 1202 begann.
Der Plan dieser Kreuzritter, Jerusalem durch eine vorher strategische Einnahme Ägyptens zurückzugewinnen, scheiterte jedoch. Die Byzantiner verweigerten den Kreuzrittern bei Konstantinopel den benötigten Proviant. Namentlich die hoch verschuldeten Kämpfer aus Venedig, die Konstantinopel sowieso als Konkurrenten in der Ägäis und als Hemmschuh für den eigenen Handel im Schwarzmeerraum betrachtet hatten, fürchteten darum, die verheißenen Gewinne in Palästina nicht realisieren zu können. Sie wendeten sich daher gegen Konstantinopel selbst, um es auszurauben. Die Stadt wurde verwüstet. Auch die Spaltung der katholischen und der orthodoxen Kirche, die im Jahre 1054 mit dem Schisma – der gegenseitigen Verfluchung per Bannbullen – begonnen hatte und bis zum Jahr 1965 dauerte, war damit endgültig vollendet.
Ebenso, wie den damaligen Kreuzrittern durch den Handel mit dem Morgenland die unglaublichsten Reichtümer im Orient erreichbar schienen, strahlte (und strahlt) der europäische Nordwesten offenbar seinerseits mit Gewinnerwartungen unfaßbarster Arten in den Süden; man sieht sich in gewisser Weise an Samuel Butlers Utopia „Erewhon“ erinnert, demzufolge es immer gerade dort besser ist, wo man gerade nicht ist, also möglichst hinter den vertrauten Bergen, auf die man sonst blickt…
Das Byzantinische Reich zerfiel nach diesem Angriff Venedigs zunächst in drei Nachfolgestaaten. Deren stärkster, das Kaiserreich Nikaia, eroberte 1261 Konstantinopel noch einmal zurück. Gleichwohl vertraute man in Konstantinopel jetzt nicht mehr den vormals Verbündeten im Westen. Gegen die weiteren Angriffe der Araber und Osmanen blieb Byzanz daher nun alleine. Im Jahre 1291 eroberten islamische Mamluken Akkon und zerstörten in der Folge alle Burgen und Städte der Kreuzfahrerstaaten, um deren Rückkehr in den Orient endgültig unmöglich zu machen. Die Südausdehnung des christlichen Abendlandes war damit gestoppt. Die Schlacht auf dem (heute kosovarischen) Amselfeld von 1389 brachte im Norden nur noch einmal vorübergehende Entlastung auch für Byzanz gegen die Osmanen. Am 29. Mai 1453 fiel Konstantinopel endgültig in die Hände des Osmanen Mehmed II.
Die sogenannte „Türkengefahr“ von 1453 verband sich – nebenbei bemerkt – im Jahre 1455 im Basel und Straßburg bei den dortigen Eliten zu einem frühen ersten deutschen Nationalismus eigener Art; dort nämlich las man den wiederentdeckten Text „Germania“ des römischen Schriftstellers Tacitus aus dem Jahre 95, der in dieser Sichtweise des 15. Jahrhunderts den Deutschen eine Sonderstellung im Christentum zuordnete.
Umbenannt in Istanbul wurde die Stadt nunmehr das Zentrum des schnell wachsenden Osmanischen Reiches (1299 bis 1922). In der Literatur wird die Auffassung vertreten, der Islam habe sich bis zu den Kreuzzügen im wesentlichen deswegen nicht für Nordeuropa interessiert, weil man sich selbst kulturell dem Norden überlegen fühlte. Der Kampf mit den Christen habe dann aber zu diversen Einigungen unter zuvor zerstrittenen muslimischen Fraktionen geführt.
Der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches 1922 und die Gründung der Türkei 1923 sind übrigens nicht nur wesentliche Mitursachen für die auf jeder Landkarte sichtbaren ‚unnatürlich geometrischen‘ Grenzziehungen zwischen Syrien, Iran und Irak, die wir heute kennen. Man geht sicher auch nicht fehl in der Einschätzung, daß die Funktionen Konstantinopels als eines breiten Grenzstreifens zwischen arabisch-islamischem Süden und christlich-europäischem Norden jedenfalls nach 1923 von der modernen Türkei unter Kemal Atatürk mit seinem konsequent laizistischen Staatsverständnis und seiner Westbindung in die NATO übernommen wurden.
Der Osmane Süleyman I. (1522 – 1566) war es jedenfalls, der dieses islamische Reich zu den Höhepunkten seines herrschaftlichen Einflusses führte. 1521 eroberte er Belgrad, 1522 wieder Rhodos und 1529 belagerte er Wien. Den zweiten Eroberungsversuch dieser Art unternahmen die Osmanen 1683 mit Prägekraft bis heute im Jahre.
Kurz: 717/718 in Konstantinopel, 732 bei Tours, 1187 in Jerusalem, 1389 im Kosovo, 1453 wieder in Istanbul, 1529 und 1689 in Wien – von den Rückeroberungen, Kreuzzügen, einem späteren Napoleon in Ägypten oder internen westlichen Schlachten in Tobruk 1941 und El-Alamein 1942 ganz zu schweigen; immer wieder läuft seit 632 eine konsequente Konfliktlinie zwischen dem Christentum im Norden und dem Islam im Süden. Die Verlockung, andernorts das eigene Glück zu finden, und die Möglichkeiten der Kooperation mit lokalen Machthabern andernorts schuf und schafft offenbar weit über Rohöl, Gewürze, Geschmeide und Bagdad-Bahn hinaus wohl immer wieder die historisch einschneidendsten Verwerfungen rund um das Mittelmeer.
6.) Zwischenergebnis
Europa scheint sich nach allem trotzdem (noch immer) nicht positiv selbst definieren zu können. Jahrhundertelang hat nur eine negative Abgrenzung nach Süden hin – mehr schlecht als recht; mal mehr, mal weniger – stattgefunden.
An die Stelle von Byzanz dürfte jedenfalls während des späten 20. Jahrhunderts wesentlich das weltweit etablierte fiat-money-System mit seinem erdölgestützten realwirtschaftlichen Bezug getreten sein. Die Industriestaaten haben das Öl aus denjenigen islamischen Ländern gekauft, die es aus ihren Böden gerade fördern konnten. Bezahlt wurde in US-amerikanischem Papiergeld, dessen Wert seit dem 15. August 1971 indes kontinuierlich verfällt. Der wenig nachhaltige Scheinreichtum der erdölfördernden Länder und ihrer nationalen Eliten ließ die historischen Nordausflüge des islamischen Einflußgebietes vorübergehend in Vergessenheit geraten. Nun aber verfällt dieses Bollwerk des Westens gegen den Süden zusehends.
Europa wird durch seine wenig funktionsfähige Europäische Union wirtschaftlich und politisch geschwächt. Gleichzeitig kommt die Kultur, gegen die sich Europa abgegrenzt hatte, nun in Gestalt ungezählter Migranten schier gegenständlich zu uns. Was tun? Kann sich Europa ohne ein positives eigenes Selbstbewußtsein überhaupt als Europa gegen die Ankommenden und ihre bisweilen sehr selbstbewußt verankerte Kultur behaupten? Zweifel sind angebracht.
7.) Sind Wertexport und Akzeptanzwerbung Bollwerke für den Frieden in Europa?
Es erscheint fraglich, ob sich „der Westen“ in Anbetracht der beschriebenen Situation im machtpolitischen Ernstfall erfolgreich als Bollwerk für unseren gewachsenen und gewohnten Lebensstil positionieren kann. Die geistigen Waffen der Überzeugung für ein besseres Leben im Wohlstand erscheinen erlahmt. Eine Akzeptanz oder gar kulturelle Adaptionen des Islam für eine gleichsam in spätkonsumistisch-beliebigem Multikulturalismus westeuropäischer Prägung verirrte Gesellschaft steht wohl nicht zu erwarten. Wenigstens drei Überlegungen stehen dagegen:
a.) Ein (geistig-kulturelles) Vakuum kann nicht expandieren; es reißt niemanden mit. Stattdessen implodiert Europa eher in der Erinnerung an seine vergehende Größe. Der Schlachtruf, nach dem der Islam zu Deutschland gehöre oder ein Teil von Deutschland sei, ist nach allem offenkundig ahistorisch und faktenblind. Schon seine Formulierung, der zufolge es nur einen einzigen Islam gebe, kündet von einer wenig intellektuellen Durchdringung der beifallheischenden Floskel.
b.) Namentlich Deutschland als territoriale Zentrale Europas ist ebenso deutlich wie nachhaltig geschwächt. Der geographische und ökonomische Kern Europas ist somit nicht das stärkste, sondern im Gegenteil sogar das an Selbstbewußtsein schwächste Glied der europäischen Familie. Seine monetäre Stärke ist mit dem Wegfall der DM gebrochen; seine persistierende historische Schuld breitet sich inzwischen sogar auch schon auf seine Anrainer aus; das Verbot von Autokennzeichen in Österreich, die Assoziationen an ruhmlose deutsche Geschichte erwecken könnten, spricht für sich. Das negative Identitäts- und Motivationsnarrativ der Deutschen namens NS-Vergangenheit schwächt heute alle Europäer. Anders als noch viele US-Bürger, die an das pull-marketing von der größten Nation glauben, sind jedenfalls Deutsche und zunehmend Europäer von dem push-marketing eines „Hinweg von der Geschichte“ rein negativ motiviert; ihr Narrativ ist nicht die Verlockung, sondern das Erschrecken. Ein solches Vakuum expandiert nicht nur nicht, es saugt in seinem Implodieren sogar Energien ab.
c.) Europa ist aktuell im Rückmarsch gegen den Islam wie wohl nie zuvor in der Geschichte. Die christlichen Kirchen sind in ihrer Politisierung und parteipolitischen Instrumentalisierung als relevante, gesellschaftlich einende Kraft faktisch zerfallen. Der Euro schwächt die Wirtschaft. Es fehlt die Begeisterungsfähigkeit nach innen und nach außen. Der mehr und mehr aufkeimende interne Streit unter den dysfunktional zwangsvereinten EU-Mitgliedern wirkt heute wohl beinahe so destruktiv und kontraproduktiv wie weiland der Angriff Venedigs auf Byzanz.
Bezeichnend ist der Satz: ‚Die internationale Gemeinschaft ist zwar international, doch selten Gemeinschaft‘, gesagt von Michael Wolffsohn im „Handelsblatt“ am 31.01.2016.
III. Schlußbemerkungen
Aus allem folgen – grob – fünf zielstellende Überlegungen:
1.) Wir Europäer müssen Europa neu erfinden, als Bürger, als Menschen, als dezentral und selbständig denkende Individuen. Wir müssen definieren, wer wir sein mögen. Wir müssen den Mut haben, uns unseres eigenen europäischen Verstandes zu bedienen. Wir müssen die Kraft (wieder-) gewinnen, uns zu unseren eigenen Werten zu bekennen und sie zu leben, ohne uns dabei auf anmaßende staatliche und überstaatliche Institutionen zu verlassen.
2.) EU-Bürokratie kann nicht leisten, heterogenen Gesellschaften eine identitätsstiftende Kultur zu empfehlen oder gar zu verordnen. Beamte haben nie etwas erfunden, konstruktive Kreativität gehört – bei aller Raffinesse eines Staatsapparates bei der abgabentechnischen Abschöpfung fremder Arbeitsfrüchte – nicht zu den Chancen politischer Verwaltung.
3.) Es bedarf einer europäischen Öffentlichkeit, die nicht zentral und interessegeleitet gesteuert ist. Sie (aus Gründen der eigenen Machtabsicherung) nicht gefördert zu haben, ist eine elementare Sünde des politischen Establishments in Europa. Diese europäische Öffentlichkeit darf auf Dauer nicht der bequemen Versuchung erliegen, ihre Stärke daraus zu gewinnen, Deutschland unter persistierendem Hinweis auf den unehrenhaften Teil seiner Geschichte zu schwächen. Die europäische Öffentlichkeit darf sich auch nicht selbst moralisch dadurch zu erhöhen versuchen, fremde Schuld als eigene anzunehmen und diese nun realpolitisch abtragen zu wollen. Wer blind ist für die Geschichte, der kann die Zukunft nicht gewinnen; doch wer die Schockstarren der Vergangenheit nicht überwindet, der kann sich auch nicht zum Wohle aller neu orientieren. Vergeben kann man sich nicht selbst, sondern nur anderen. Europa insgesamt hat nach allem auch ein ganz eigenes Interesse, Deutschland und seiner Geschichte gegenüber Nachsicht walten und den Blick in die Zukunft wagen zu lassen.
4.) Wenige europaweit bekannte EU-Politiker und EU-Verwalter und/oder einige etablierte „Staatsschauspieler“ ersetzen keine gemeinsame Bühne für eine Gesamtidentifikation. Vor uns liegt die Aufgabe, positive Beispiele für europäische Persönlichkeiten zu finden, die das zu formulierende europäische Narrativ lebendig erzählen können.
5.) Unsere gewachsene mediterrane Kultur – vielleicht sogar nach dem byzantinischen Dreiklangmuster aus christlichem Glauben, griechischer Kultur und römischer Verwaltung – kann sich auf Dauer nur behaupten, wenn sie sich selbst und selbstbewußt definiert. Zu den elementarsten Grundbausteinen eines solchen erfolgreichen Europa gehören die Herrschaft des verläßlichen Rechts, der Abschied vom unverläßlichen Primat der Politik und die Definition eines erkennbaren gegenständlich-territorialen Raumes, innerhalb dessen all das stattfindet. Denn das hilft – im beiderseitigen Befriedungsinteresse – zuletzt sogar allen Nachbarn, die dann wissen, worauf sie sich einstellen können.
***