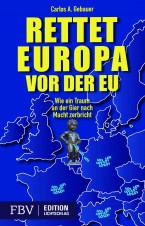Referat auf der Tagung des Bundes Freiheit der Wissenschaft e. V. am 9. Februar 2007 in Gummersbach
Sehr geehrte Damen,sehr geehrte Herren,
gestatten Sie mir, einer liebgewonnenen Gewohnheit nachzugehen. Lassen Sie mich mein heutiges Thema in drei Teilen vortragen: In Einleitung, Hauptteil und Schluß.
Der juristische Blick auf unsere gegenwärtige Gesellschaft erweist: Das Zivilrecht befindet sich kontinuierlich auf dem Rückzug. Auf allen Ebenen der Gesetzgebung – von den einzelnen Bundesländern über den Bund selbst bis hin zur EU – sind unsere Gesetzgeber damit befasst, unser Leben entweder insgesamt öffentlich-rechtlich auszugestalten, oder aber noch bestehende individuelle rechtliche Gestaltungsspielräume aller Beteiligter konsequent einzuengen.
Mit einer derartigen Gesetzgebung werden aber nicht nur unsere je eigenen, einzigartigen, individuellen Lebensentwürfe standardisiert. Die Entscheidungsbefugnisse aller Bürger werden vielmehr insgesamt zwangsläufig weiter und weiter minimiert.
In der Bundesrepublik Deutschland geht es schon lange nicht mehr nur um rechtsdogmatische Skurrilitäten wie etwa den ganz aus dem Ruder gelaufenen arbeitsrechtlichen Kündigungsschutz[1] oder die ähnlich bemerkenswerten Mieterschutzregeln nach den §§ 568 ff. BGB, mit denen bei letzter legislativer Gelegenheit gleich auch noch die gesamte Aufbaulogik des Bürgerlichen Gesetzes in ihr Gegenteil verdreht wurde[2].
Aus den normhierarchisch übergeordneten Sphären der Europäischen Union drängen weitere Einschränkungen der Bürgerfreiheiten in das nationale Recht. Die durch europarechtliche Pauschalreiserichtlinie veranlasste Kundengeldabsicherungspflicht des Reiseveranstalters nach § 651k BGB[3] etwa stellt ebenso eine Behinderung des freien bürgerlichen Handelns und Wirtschaftens dar, wie weite Teile des Rechtes über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB)[4].
Als wäre dies alles dem alltäglichen Leben der Bürger – namentlich den arbeitenden Menschen – noch nicht hinderlich genug, arrondiert der Gesetzgeber derartige Regelwerke zusätzlich noch dadurch, dass er z.B. sogenannte „qualifizierte Einrichtungen“ ermächtigt, gegen (ohnehin rechtlich unwirksame!) Allgemeine Geschäftsbedingungen gerichtlich vorgehen zu dürfen[5]. Oder dass er mit einer eigenen Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach Bürgerlichem Recht[6] die Unternehmer bisweilen zur Aufführung und Benennung von rund zwanzig katalogisch aufgeführten Zwangsangaben in seiner alltäglichen geschäftlichen Korrespondenz belastet[7]. Es will scheinen, als befürchte kein an derartigen Gesetzesvorhaben Beteiligter, eines Tages selbst im wirklichen Leben außerhalb des Parlamentes oder Ministeriums vor die Aufgabe gestellt zu sein, alle diese Vorschriften beachten zu müssen.
Den allerjüngsten Kulminationspunkt unsäglichen, nicht zuende gedachten legislativen Gebarens auf zivilrechtlichem Gebiet markiert das nun unter dem Namen „Allgemeines Gleichstellungsgesetz“ in Kraft getretene sogenannte Antidiskriminierungsrecht. Dieses Gesetz nötigt Bürger allen Ernstes in rechtswirksame Vertragsverhältnisse, auch wenn sie diese innerlich ablehnen. Es handelt sich folglich um ein legislatives Monstrum, das allem dient, nur nicht der Schaffung von tatsächlichem Rechtsfrieden unter Bürgern. Es ist daher vielerlei, nur jedenfalls nicht mehr Bürgerliches Recht[8].
Was aber können wir – namentlich unter den damit skizzierten gesetzgeberischen Umgebungsbedingungen – noch unter einer „Bürgergesellschaft“ verstehen? Was kennzeichnet ihr Zivilrecht? Und: Wie besinnt sich eine Gesellschaft auf jenes Recht, dass es auch wieder tatsächlich zur Geltung komme?
Ich möchte meine Überlegungen zum Thema in der Hauptsache in zwei Teilen darstellen. Zunächst will ich definieren, was ich unter einer „Zivilgesellschaft“ verstehe (und welche Vorteile sie gegenüber anderen Gesellschaftsmodellen hat). Dann werde ich mich mit der Frage befassen, was wir anzustellen haben, um eine solche Zivilgesellschaft (wieder) in die Welt kommen zu lassen.
Zunächst ist also zu fragen: Was eigentlich kennzeichnet eine solche Zivilgesellschaft? Zwei Elemente erscheinen mir hierbei besonders charakteristisch und wesentlich: Zum einen die „horizontale“ oder „gleichberechtigte“ Verbindung der Beteiligten und zum anderen die konkrete Festlegung gemeinsam verfolgter Zwecke durch die jeweils persönlich Beteiligten selbst.
Die juristische Literatur verwendet zur Unterscheidung ihrer Gegenstände „öffentliches Recht“ einerseits und „Zivilrecht“ andererseits üblicherweise zwei bildhafte Begriffe: Die „Über-Unter-Ordnung“ verschiedener Rechtssubjekte zueinander kennzeichnet das öffentliche Hoheitsrecht, während die „Gleich-Ordnung“ mehrerer Rechtssubjekte zueinander das bürgerliche, zivile Recht prägt.
Während also eine Behörde dem Bürger mit ihren Möglichkeiten zum Erlaß von Verwaltungsakten „vertikal“ übergeordnet ist, stehen sich zwei Bürger bei dem Abschluß und der Durchführung eines Vertrages untereinander gleichsam in gleicher Augenhöhe auf einer einheitlichen, „horizontalen“ Ebene gegenüber. Im öffentlichen Recht herrscht demnach also gerade nicht „gleiches Recht für alle“; sondern die Behörde hat das bessere, stärkere Sonderrecht gegenüber dem Bürger.
Genau das aber bleibt nicht ohne Konsequenzen für jedweden rechtlichen Dialog zwischen den an solchen Rechtsverhältnissen Beteiligten. Wer nämlich einen anderen zu bestimmten Handlungen zwingen kann, der argumentiert – aus naheliegenden (und nachstehend im einzelnen zu erläuternden) – Gründen anders als einer, der den anderen Partner seines Rechtsverhältnisses erst zu diesem von ihm angestrebten Tun überzeugen muß. An die Stelle der einvernehmlichen (und ganz friedlichen) Einigung zwischen Gleichberechtigten tritt im öffentlichen Hoheitsrecht bestenfalls eine vorherige Anhörung des Schwächeren mit einer anschließenden (einsam-autonomen) Entscheidung des Stärkeren.
Die damit umrissene Differenzierung im praktizierten Rechtsverkehr zwischen entweder „horizontal“ oder aber „vertikal“ miteinander agierenden Beteiligten kann nicht ohne Auswirkungen auf den Inhalt ihres Kommunizierens, insbesondere aber auch nicht ohne Auswirkungen auf den Inhalt ihres Handelns insgesamt bleiben.
Denn wer einen gleichberechtigten Partner erst davon überzeugen muß, gemeinsam mit ihm einen bestimmten Zweck zu verfolgen, an dessen konkrete Darlegungs- und Begründungsanstrengungen sind ganz andere Anforderungen gestellt, als an einen, der das von ihm vorgestellte anschließende Handeln des anderen auf alle Fälle – also insbesondere ohne Rücksicht auf das Ergebnis eines vorab vielleicht noch anhörend geführten Dialoges – „von oben herab“ einsam und monologisch erzwingen kann.
Gleichsam rein und archetypisch ist der Gedanke eines derartigen, gleichberechtigten Konsenses als Voraussetzung zur anschließend gemeinsamen Verfolgung eines übereinstimmend als sinnvoll erkannten Zieles in § 705 BGB beschrieben:
„Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten.“
Diese Formulierung betont gleich vierfach (!) den gemeinsamen Willen der Beteiligten: Sie schließen erstens einen „Vertrag“. Sie definieren zweitens hierzu einen „gemeinsamen Zweck“. Dazu setzen sie drittens die „bestimmten“ Mittel ein. Und viertens leisten sie die „vereinbarten“ Beiträge. Mehr Konsens geht kaum.
Daß die einzelnen Tatbestandsmerkmale dieses bürgerlich-rechtlichen Gesellschaftsvertrages (bei einer hier einmal unorthodox angenommenen, extensiven Auslegung) schlechterdings auch auf jeden zweiseitigen Vertrag Beteiligter „passen“, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Stets verständigen sich die Partner eines zivilrechtlichen Vertrages „horizontal“ auf den gesamten Inhalt dessen, was sie (nach ihrer gemeinsam als je individuell sinnvoll erachteten Weltsicht) als ihre Ziele mit dem Vertrag sinnvoll zu erreichen wünschen. Was nur einer wünscht und will, ist hier so lange irrelevant, wie er den anderen nicht für dieses Ziel begeistert.
Das konkrete Bündnis der Beteiligten erhält auf diese Weise seine ganz eigene, konkrete, dezentrale und privatautonom nur von den Beteiligten im Konsens definierte Finalität in der Welt.
Ändert sich der konkrete Blick der Beteiligten auf ihren Zweck, stellen sie übereinstimmend fest, dass er nicht mehr verfolgt werden kann, oder beschließen sie, die Lust an der Zielerreichung allseits verloren zu haben, dann beenden sie einvernehmlich ihren alten Konsens und schaffen sich einen neuen. Gelingt ihnen aber nicht, gemeinsam einen neuen Konsens zu finden, bleibt es bei der Verbindlichkeit des alten. Das schafft genau diejenige rechtliche Sicherheit, derer alle Beteiligten an einem Vertrag bedürfen und die sie an derartigen Geschäften auch stets zu schätzen gelernt haben.
Hiermit ist folglich eine hohe konkrete Flexibilität für die Beteiligten verbunden. Sie können sich in eigener Verantwortung jederzeit wieder neu einigen, ab sofort etwas ganz anderes zu wollen und zu erstreben. Die gemeinsame Finalität lässt sich jederzeit an neueste (auch schicksalhafte) Entwicklungen anpassen.
Genau hier nun tritt aber eine weitere Dimension der „horizontalen“ Zweckverfolgung vor Ort durch die konkret Beteiligten auf die Szene. Es ist dies die Dimension der philosophischen Erkenntnistheorie (Epistemologie). Erkenntnistheoretiker wissen bekanntlich: Es ist stets nur all das im Hirn eines Menschen, das irgendwann einmal dort hineingekommen ist. Wer blind geboren wurde, dessen Hirn weiß nicht, was eine Farbe ist. Es wäre fruchtlos, ihm mit Worten das Entstehen von grün aus blau und gelb anschaulich erklären zu wollen.
Für jedes angepasste Verhalten ist aber dringend notwendig, mit den eigenen Sinnen ein realitätsgetreues Bild von der Welt zu haben. Der Blinde ist folglich lebensnotwendig darauf angewiesen, auf anderen Erkenntniswegen schnell und zuverlässig von einer roten Ampel zu erfahren. Sonst droht ihm ebensolche Lebensgefahr, wie einem Wanderer in der Wüste, der mit letzter Kraft auf eine nur vermeintlich wasserspendende Fata Morgana zuläuft.
So müssen wir Menschen also – ebenso wie viele Tiere – unserem Schicksal dankbar sein, dass es uns Augen und Ohren so nahe bei unserem Hirn beschert hat. So können wir in der Regel zügig Änderungen in unserer Umgebung erkennen und unser – wiederum hirngesteuertes – Handeln darauf einstellen. Das sichert unser Überleben.
Diese Chance zur schnellen Umsetzung erkannten Wissens in unser an die jeweilige Umgebung angepasstes Handeln hat indes auch ganz massive rechtliche Dimensionen. Epistemologisch macht es nämlich einen gehörigen Unterschied, ob Menschen in horizontaler oder in vertikaler Weise rechtlich miteinander verbunden sind. Sieht beispielsweise der Käufer A, dass eine ihm von B verkaufte Scheune infolge Blitzschlages vor Übergabe und Bezahlung in Flammen aufgeht, werden beide Vertragsparteien jedes weitere Handeln in Richtung auf eine Durchführung ihres ursprünglichen Vertrages auf der Stelle einvernehmlich beenden. Ihr Handeln setzt die gewonnene neue Erkenntnis sofort sinnvoll um.
Wüßte aber – um im Beispiel zu bleiben – der Käufer A gar nichts von dem Verbrennen der Kaufsache, so würde er weiter in der Vorstellung von einer Durchführbarkeit des Vertrages leben. Und: Er würde sich nach Maßgabe dieser seiner (unzutreffenden) Überzeugung verhalten. Damit aber stünde sein gesamtes weiteres Handeln nicht mehr im Einklang mit der Realitäten der Welt.
Genau dies aber ist die grundsätzliche Ausgangssituation aller nur öffentlich-rechtlich ausgestalteter Rechtsverhältnisse: Wenn (und weil) die „befehlende“ Instanz in aller Regel nicht selbst persönlich anwesend und beteiligt ist, sondern nur aus der Ferne ihrer Amtsstube auf unsicherer – gegebenenfalls schon überholter – Tatsachengrundlage entscheidet, hat sie gegenüber zivilrechtlichen Verhältnissen einen strukturellen epistemologischen Nachteil.
Wenn also rechtlich „übergeordnete“ Instanzen über die Pflicht zum Handeln, Dulden und Unterlassen „untergeordneter“ Rechtssubjekte zu befinden haben, dann fehlt es nicht nur meist an der Freiwilligkeit des Mitwirkens. Es mangelt der Entscheidung insbesondere stets auch an all denjenigen spezifischen tatsächlichen Erkenntnissen, die nur der jeweils Betroffene vor Ort in seiner Person höchstselbst hat machen können. Die vertikal getroffene Entscheidung basiert daher stets auf unsicherer(er) Tatsachengrundlage, als eine Entscheidung, die (nur) die Beteiligten selbst getroffen hätten. Die hoheitliche Entscheidung ist schon alleine daher überwiegend wahrscheinlich faktisch unrichtig[9].
Wesentlicher aber noch scheint, dass die hoheitlich getroffene Entscheidung in ihrer Finalität einen gänzlich anderen Handlungsrahmen berücksichtigt und einbezieht, als ihn die Betroffenen selbst berücksichtigt hätten. Denn je mehr Personen von einer (rechtlichen) Entscheidung betroffen sind, desto mehr potentielle Finalitäten aller Beteiligten werden durch die Handlungsanordnung berührt.
Lassen Sie mich zur Verdeutlichung dieses Gedankens ein ebenso einschneidendes, wie plastisches Beispiel heranziehen. Ich zitiere aus Winston S. Churchills Bericht[10] über die Konferenz von Teheran im Jahre 1943 und das dort skizzierte weitere Schicksal des polnischen Staatsgebietes[11]:
über Polen an. Stalin willigte ein und forderte mich auf, zu
beginnen. … Ich für meinen Teil glaube, Polen könnte sich
nach Westen verlagern, wie Soldaten, die seitlich wegtreten. Falls es
dabei auf einige deutsche Zehen trete, könnte man das nicht
ändern … Stalin fragte, ob wir gedacht hätten, dass er
Polen schlucken wolle. Eden erwiderte, wir wüssten nicht, was
Russland alles zu verspeisen gedenke. … Stalin erklärte, die
Russen wollten nichts, was anderen Völkern gehöre, nur aus
Deutschland würden sie sich vielleicht auch einen Brocken
herausschneiden. Eden meinte, was Polen im Osten verliere, könnte
es im Westen gewinnen. … Ich demonstrierte dann mit Hilfe dreier
Streichhölzer meine Gedanken über eine Westverlagerung
Polens. Das gefiel Stalin …“
Wer könnte angesichts solcher öffentlich-rechtlich-vertikaler Lenkung durch die agierenden Staatsmänner glauben, dass die sozusagen „zur Seite tretenden Streichhölzer“ persönlich – bei eigener horizontaler Entscheidungsbefugnis – auch nur in größerer Zahl ernstlich in Betracht gezogen hätten, beim Verspeisen fremder Landbrocken irgendjemandem auf die Zehen zu treten?
Oder, umgekehrt und weniger dramatisch: Was würde wohl geschehen, wenn man – jede Ähnlichkeit mit real existierenden Verhältnissen wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt – einer bürokratischen Organisation aus z.B. Gemeinden, Kreisen, Landschaftsverbänden, Ländern, einem Bund und einer EU mit 27 Mitstaatsentscheidern die Aufgabe stellen würde, einen Käsekuchen zu backen oder eine Spülmaschine zu befüllen? Wer fängt an? Womit genau? Wie lange dauert es? Was kostet es? Wer bezahlt?
(und haben) Menschenmaß
Die mit Befehlsbefugnissen ausgestattete Entscheidungsbefugnis einzelner Menschen (oder Gruppen) über eine anonyme Masse anderer Menschen führt also zwangsläufig zur Störung oder gar Zerstörung anderer, persönlicher, privater, individueller, bürgerlicher Finalitäten, wenn und weil diese den jeweiligen Befehl empfangenden Menschen nicht an einer (einvernehmlichen) Vereinbarung der zu erreichenden Zwecke beteiligt wurden[12].
Die Idee einer demokratischen Legitimierung solcher Großentscheidungen qua Wahlrecht ist erkennbar ein nur äußerst unzulängliches Surrogat für tatsächliche unmittelbare und zivilrechtliche „Bürgerbeteiligung“ im ureigentlichen Sinne. Für den Bereich des bundesrepublikanischen Sozialrechtes hat der Regensburger Rechtswissenschaftler Thorsten Kingreen diesen Gedanken in den Satz gefasst:
„Im demokratischen Sozialstaat werden Entscheidungen, die nach bestimmten formalen, sachadäquaten und anerkannten Regeln zu Stande gekommen sind, auch dann akzeptiert, wenn sich über das, was im Einzelfall sozial gerecht ist, kein Konsens erzielen lässt.“[13]
An dieser Stelle lauern nach allem wenigstens zwei Dilemmata:
Das Dilemma Nr. 1 ist: Wenn die Klein(st)gruppe der Entscheidungsträger intern eigene Finalitäten entwickelt, die mit denen der verwalteten „untergeordneten“ Bürger nicht mehr übereinstimmt, dann kommt es zu Interessenkollisionen zwischen Ober- und Unterebene. Denn jede Gruppe entwickelt ihre eigene übersichtliche Zweckbündnis-Logik. Dies ist das große Thema der „politischen Klasse“[14]. Ab einem bestimmten Punkt stört die Meta-Ebene nur noch das Leben der Primär-Ebene. Es kommt also zur Entstehung neuer, hyperkomplexer Konfliktlagen, statt zur Bereinigung der vergleichsweise übersichtlichen alten.
Das Dilemma Nr. 2 ist: Wenn eine mit Befehlsgewalt ausgestattete, vertikal übergeordnete Ebene immer weiter und detaillierter in die jeweiligen Konkretheiten der Bürger und ihre sämtlichen elementaren Lebensentscheidungen oder Lebensbedingungen hineinregiert, dann kommt es zwangsläufig zu Kollisionen mit elementaren ethischen und insbesondere auch verfassungsrechtlichen Maßstäben, wie z.B. erkennbar in einer – nicht ohne Grund vielbeachteten – Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes über Rechtssetzungsbefugnisse einer Behörde in Fragen der Gesundheitsversorgung vom 6. Dezember 2005[15]. Danach darf eine Behörde gerade nicht über Leben und Tod eines zwangsweise „gesetzlich“ versicherten Patienten befinden.
Kurz: In der Überkomplexität der legislativen und exekutiven Hyperregulierung kommt dem Alltagsleben das Menschenmaß abhanden. Die Zivilgesellschaft aber ist das klassische und allein eigentliche Instrument zur Wahrung des Menschenmaßes[16].
Alleine eine kooperative und auf individuellen Verträgen aufgebaute Zivilgesellschaft bleibt für die Beteiligten und Betroffenen übersichtlich und für sie selbst rational steuerbar. Ferngesteuerte Großeinheiten kollabieren unter ihrer eigenen Trägheit und Blindheit[17]. Zuletzt verlieren sie ihre Funktionalität.
Eine Gesellschaft, die den Anspruch hat, das Individuum zu achten, kann nur einen Staat mit schlanken Verwaltungs- und Herrschaftsstrukturen akzeptieren. Denn der behutsame Umgang mit dem einzelnen erfordert Demut, Respekt, Beschränkung, Zurückhaltung und steten Zweifel an der Richtigkeit ihres Handelns aller derjenigen, die Macht ausüben. Wer aber unter allen Umständen seinen Willen gegen den der Bürger durchsetzen möchte, der kann sich solche Vornehmheiten nicht leisten. Er muß mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln erkennen, erforschen, entscheiden und durchsetzen[18].
Die historischen Beispiele für all dies sind hinlänglich bekannt. UdSSR, DDR, Maos VR China wie alle übrigen sozialistischen und Kommunistischen Regime scheiterten nicht an Naturkatastrophen, sondern an ihren eigenen internen Strukturen, die genau diese hier skizzierten Probleme aufwiesen.
Absurd ist insbesondere die noch immer verbreitete Polemik der Gegner zivilrechtlicher Gesellschaftsstrukturen, wonach ein von seinen Bürgern geschaffener Markt nur „kalte Ellenbogen“ generiere. Im Gegenteil hat gerade ein öffentlicher Verwaltungsakt solche kalten Ellenbogen. Wer sich vertragen will (und muß), der agiert notwendig mit offenen Händen, die sich einander zum Vertrag gereicht werden, nicht aber mit Ellenbogen.
Schließlich hat die Geschichte immer wieder erwiesen: Wir Menschen sind keine Heiligen. Nur wenn wir unsere Mitmenschen überzeugen und einbinden müssen, handeln wir human. Wer dagegen zwingen kann, wird – früher oder später – stets zum Tyrannen.
Zivilgesellschaft
Alles Gesagte ist im Grunde jedem, der es wissen möchte, lange bekannt, rational nachvollziehbar und in sich plausibel. Aber wie kommt es, dass diese Rationalität in unserer alltäglichen Welt nur so wenig Gehör findet? Ist also eine solche Zivilgesellschaft jenseits ihrer schönen Theorie überhaupt in der Welt tatsächlich möglich? Und wenn ja: Wie stellt man sie her?
Versuchen wir also zunächst noch eine kleine Analyse, bevor wir die Frage nach Handlungs-Chancen hin zur konkreten und faktischen Schaffung einer Zivilgesellschaft stellen.
(non-ideologische) Nicht-Organisation
Eine Zivilgesellschaft im hier beschriebenen und verstandenen Sinne als freier Zusammenschluß gleicher Bürger auf „horizontaler“ Ebene ist nicht hierarchisch gegliedert. Jede Organisationsstruktur reicht stets nur so weit, wie die konkrete Einigung der Beteiligten. Die maximale Größe eines jeden zivilrechtlichen Bündnisses (und seiner gemeinsam vereinbarten Finalitäten) wird durch die Vorstellungs- und Willenskräfte seiner konkret beteiligten Personen vorgegeben.
Während in einer öffentlich-rechtlichen Gesellschaft ein einziger Befehl ausnahmslos alle Rechtsgenossen erreichen (und verpflichten) kann, erscheint dies wegen der konkret beschränkten Einigungsmöglichkeiten einzelner Individuen „horizontal“ unmöglich.
Dies ist zwar einerseits von Vorteil, weil es Tyranneien und Gewaltherrschaften (jedenfalls im Mega-Format) verunmöglicht. Andererseits sind derartige Zivilgesellschaften stets dann im Nachteil, wenn es gilt, sich gegen quasi-militärisch organisierte Gesellschaftskonzepte abzugrenzen und zu verteidigen.
Eine Gesellschaft, die sich auf das dezentrale Entdecken ihrer Mitglieder mit allen ihren Sinnen und Kreativitäten konzentrieren möchte, kann nicht mit denselben Heilsversprechungen operieren, wie ein gegenteiliges Konzept, das einen konkreten Plan zu haben und dessen Durchsetzbarkeit zu beherrschen vorgibt.
Insofern bedient das „vertikale“ Modell auch noch – anders als das „horizontale“ – ein ganz besonderes menschliches Bedürfnis: Menschen wollen gerne entlastet sein. Und sie bevorzugen das Bequeme gegenüber dem (vermeintlich) Unangenehmeren[19]. Mithin liegt in dem Heilsversprechen der zwangsweise herstellbaren Ordnung stets auch der geradezu erotische Reiz, auftretende Probleme ließen sich allesamt lösen. Sofern man es nur mit allen Machtmitteln wirklich, wirklich wollte!
Vorschub leistet hierbei eine sehr anschauliche optische Täuschung: Ebenso, wie sich beobachten lässt, dass mit staatlichen Machtmitteln Räuber verfolgt und gefangen werden können, Steuergelder eingetrieben und in den Bau imposanter Gebäude geleitet werden können, so muß wohl auch – meint der unbedarfte Betrachter – per vertikalem Befehl allgemeiner Wohlstand einer Gesellschaft geplant und herbeiverfügt werden können[20].
Daß aber Kreativität nicht befohlen und vollstreckt werden kann, liegt auf der Hand. Andernfalls müsste möglich sein, unter der Androhung von Zwangsgeldern und Ordnungsmitteln (oder durch das Inaussichtstellen von Freiheitsstrafen etc.) Menschen zu bewegen, Gedichte zu schreiben, Sonaten zu komponieren oder beeindruckende, künstlerisch wertvolle Gemälde an Kirchendecken zu malen. Mehr noch: Der Befehlshaber hätte gerade diejenige Idee, die noch gar nicht in der Welt ist, weil ihr kreativ-genialer Erfinder sie noch nicht gedacht hat, schon vorausahnen und –haben müssen, um eine entsprechende Anweisung erst erteilen zu können. Das aber widerspricht greifbar aller zeitlichen Logik (zumindest unseres bekannten Universums)[21].
Dennoch bleibt das politische Versprechen, Glück mit Machtmitteln herbeizwingen zu können, ein gerne gehörtes. Und je vehementer das Versprechen vorgetragen wird, desto begieriger wird es von einem jeden Bequemlichkeits-Freund gehört und geglaubt. Hierbei haben sich straff organisierte und quasi-militärisch aufgestellte Heilsboten-Bündnisse als erfolgreich erwiesen. Die staatliche Organisation schlägt bislang erfahrungsgemäß immer die zivilgesellschaftliche Nicht-Organisation. Nicht zuletzt die Fahnen und Melodien, die Aufmärsche und das wohlige Teilnahme- und Teilhabe-Gefühl solcher Massen tun ihr Übriges zu diesen Erfolgen.
Aber auch die Geschichte der römisch-katholischen Kirche und ihrer Auseinandersetzung mit dezentral-lokalen Ortskirchen gibt ein nachvollziehbares Bild dieser Mechanismen[22]. Die Geschichte der Arbeiterorganisationen bis hin zum Sowjetstaat steuert weitere Exempel bei.
Bezeichnend ist auch, dass das Gegenmodell schlanker Staaten mit individuellem Wohlstand stets dort – vorübergehend – erstarkte, wo vertikale Machtstrukturen (noch) nicht (wieder) existierten: Die Siedler der USA drangen in staatlich unverwaltetes Gebiet vor und schufen die stärkste Volkswirtschaft der Welt – bis die staatliche Organisation nachzog, mit den bekannten Konsequenzen. Die junge Bundesrepublik Deutschland wies eine völlig zerstörte Infrastruktur bei gleichzeitig zunächst fehlenden breiten Eliten auf. In konkreter Ansehung aller Beteiligten, dass keine Macht der Welt dem einzelnen etwas vom Nachbarn umverteilen konnte, weil auch der nicht besaß, entstand das – irritierend so genannte, denn in dieser Lage gar nicht verwunderliche – „Wirtschaftswunder“. Schließlich konnte auch Margaret Thatcher nur deswegen vorübergehend so segensreich agieren, weil die gewerkschaftlichen Machteliten ihres Landes 1979 faktisch insolvent und damit handlungsunfähig waren[23]. Ludwig von Mises formulierte hierzu bereits im Jahre 1919:
„Der Liberalismus, der volle Freiheit der Wirtschaft fordert, sucht die Schwierigkeiten, die die Verschiedenheit der politischen Einrichtungen der Entwicklung des Verkehrs entgegenstellt, durch Entstaatlichung der Ökonomie zu lösen.“[24]
Sollte aber ein menschlicher Wohlstand durch eine entstaatlichte Ökonomie tatsächlich immer nur dort entstehen können, wo zuvor eine jede Staatlichkeit fehlt oder gerade in Fortfall geraten ist?
Wie also läßt sich in Ansehung all dessen eine Zivilgesellschaft schaffen und verwirklichen? Braucht sie stets den vorangehenden Zusammenbruch eines vertikalen Systems als ihren Nährboden? Und: Ist die Zivilgesellschaft immer im Hintertreffen gegenüber dem vertikalen Modell?
Ich glaube (und möchte glauben): Nein. Die Schwierigkeit scheint mir zunächst zu sein, dass horizontale Zivilgesellschaften aus gleichen Bürgern sich nach Staatszusammenbrüchen vielleicht vorübergehend „Zepter und Reichsapfel“ erobern. Dann aber lassen sie diese wieder unbeachtet herumliegen, weil sie sich ihrer nicht bedienen mögen. Das genau ist die Stunde all derjenigen, die nicht produktiv-kreativ sein mögen, sondern allenfalls administrativ-kreativ.
Tatsächlich ist der „Markt“ als Organisationsphänomen ja auch nie endgültig ausgeschaltet. In der Krise bewährt er sich gerade als sogenannter „Schwarz“markt sowie – zur Überlebenssicherung in kommunistisch kaputtzerwirtschafteten Volkswirtschaften – in der Gestalt von Korruption. Werden „vertikal“ Subventions-Sondermärkte geschaffen, dockt er hier ebenfalls an. Der Markt ist faktisch ein Naturgesetz. Denn nur wenn Menschen sich konkret im Tausch einigen können, vermögen sie auch konkret ihr Leben zu sichern[25].
Wie aber aktualisiert man dieses Wissen vor der ausbrechenden Krise? Damit sie am besten erst gar nicht eintritt?
Gegenüber den Sozialismen in allen Spielarten, angefangen vom hard-core Kommunismus bis hin zum Sozialdemokratismus, steht die Zivilgesellschaft in einer denkbar ungünstigen Ausgangsposition. Im Hinblick auf ihr Marketing nämlich ist jede Variante der politischen Heilslehre ihr zunächst weit überlegen. Wer behaupten kann (und will), der Allgemeinheit das Glück und den Reichtum zu bescheren, der findet eher Gehör, als derjenige, der die Menschen zuerst auf ihr eigenes Geschick und ihre persönliche Kreativität hinweist.
Für den klassischen Kapitalismus in seiner definitorischen Abgrenzung zu sozialistischen Wohlfahrtsstaaten formuliert Roland Baader deutlich:
„Es steht also nicht –ismus gegen –ismus, sondern System gegen Non-System, Eingriffsideologie gegen Nichteingriffs-Ideologie, Dogma gegen Erfahrung“[26]
Nichts anderes gilt für die Abgrenzung zu einer Zivilgesellschaft. Auch sie ist nichtideologisch, nichteingreifend, gewährend und Erfahrung respektierend. Folglich können ihre „Werbebotschaften“ nicht ebenso populistisch und grell daherkommen, wie die einer das Glück verheißenden Heilslehre.
Gleichwohl bedarf die Zivilgesellschaft souveräner Bürger, die voller Enthusiasmus und in ganzer Überzeugung laut die Stimme für sie ergreifen. Jede rhetorische Zurückhaltung gegen Sozialismen aller Art verbietet sich daher absolut. Sozialistische Theorien sind nicht irgend bedenkenswerte, ernstzunehmende oder noch diskutable Gegenentwürfe, sondern schlicht empirisch widerlegte und vielfach allerorts gescheiterte Konzepte, denen keine intellektuelle Gnade gebührt. Im Gegenteil. Wer im wissenschaftlichen oder auch nur allgemeinen öffentlichen Dialog wohlfahrtsstaatliche Theoreme noch ernstlich zu widerlegen bereit ist, statt sie als offenen Unsinn oder abgewickelte Geschichte zu kennzeichnen, der verhält sich wie einer, der minutiös auf die Behauptung eingeht, die Sonne drehe sich um die Erde.
Problematisch bleibt nur die weiterhin persistierende sozialistische Marketing-Anmaßung, sie verfolge ganz selbstlos den guten, sozial gerechten Zweck. Die Delegitimierung dieser Behauptung durch die induktive Demaskierung jeder dieser Einzelverheißungen bleibt ein mühseliges Geschäft, das Tag für Tag allerorten auf seine Erledigung wartet. Empirisches Material zur anschaulichen Argumentation findet sich ersichtlich zuhauf.
Die einzelnen, konkreten Wege zurück zum Menschenmaß einer zivilen Gesellschaft können nur wir alle in den jeweiligen, sich uns bietenden Situationen finden und beschreiten. Sie lassen sich nach allem Gesagten eben nicht zentral definieren und weisen. Aber erst wenn wir uns frei machen von der Vorstellung, alles und jedes von einem allgegenwärtigen Staat „vertikal“ von oben herab auf entsprechenden Antrag hin zugewiesen erhalten zu können, dann kann unser Zusammenleben wieder werden, was es sein sollte: zivilisiert.
Nach § 1 Kündigungsschutzgesetz kann ein Arbeitgeber einen
Arbeitsvertrag grundsätzlich nur dann regulär kündigen,
wenn die Kündigung „sozial gerechtfertigt“ ist. Das
erfordert rechtswissenschaftliche Interpretationsanstrengungen, die
in den gängigen juristischen Kommentaren inzwischen mehrere
hundert Seiten umfassen. Und es verschafft umtriebigen
Arbeitsrichtern einen Quell attraktiver Zusatzeinkünfte nicht
nur durch das regelmäßige Verfassen einschlägigen
Kommentarliteratur, sondern auch durch das Angebot von
entgeltpflichtigen Fortbildungsveranstaltungen, auf denen sie „ihre“
prognostische Rechtsprechung akademisch erläutern.
Eine intellektuelle Höchstleitung des historischen Gesetzgebers
bei der Schaffung des Bürgerlichen Gesetzbuches war, alle
Regelungen begriffsjuristisch in „vor die Klammer gezogene“
allgemeine und erst dann in spezifische besondere Teile aufzuteilen,
um den Regelungskanon übersichtlich zu halten. Die Abschnitte
über das Mietrecht haben diese Systematik nach gut hundert
Jahren jetzt aufgegeben. In der Kommentierung von Hubert Blank und
Ulf P. Börstinghaus (Neues Mietrecht, München 2001) heißt
es hierzu trocken: „Dieser neue Aufbau hat zur Folge, dass
bisher zusammenhängende Vorschriften nunmehr
auseinandergerissen werden.“ (a.a.O. Vorbemerkung II zu den
Anhängen, ibid. S. 176)
Im Falle der Insolvenz seines Reiseveranstalters soll sichergestellt
werden, dass der buchende Tourist gleichwohl wieder sicher nach
Hause zurückgebracht wird; so zieht der – erwachsene! –
Weltenbummler hinaus, gilt seinem Gesetzgeber aber als zu unbedarft,
um selbständig wieder heimzufinden.
Diese gesetzlichen Bestimmungen nämlich machen beinahe
vollständig unmöglich, dass sich ein Verwender das
typischerweise für den Bedarf seines eigenen, spezifischen
Geschäftes notwendige Vertragsrecht einmal für eine
unbestimmte Vielzahl vergleichbarer Geschäftsvorfälle
vorbereitet.
vgl. §§ 3, 4 UnterlassungsklagenG
vgl. § 1 BGB InfoV
faszinierend an dieser Verordnung ist nicht nur ihr augenscheinlich
schon unzutreffender Name (denn ersichtlich kann angesichts
derartiger einseitiger und nicht abdingbarer Informationszwänge
nicht ernstlich mehr von „bürgerlichem Recht“
gesprochen werden, was – in anderen Zusammenhängen – schon
die klauselrechtliche und/oder wettbewerbs- und markenrechtliche
Frage nach ihrer Bezeichnungswahrheit aufwürfe), sondern
insbesondere, dass beispielsweise selbst das amtliche Muster eines
Sicherungsscheines nach § 14 dieser Verordnung in praxi
bereits als gesetzeswidrig angesehen wird; vgl. Palandt-Grünberg,
BGB-Kommentar mit Nebengesetzen, München, 66. Aufl., 2007, § 14
BGB-InfoV Rn 5 mit weiteren Verweisungen auf die obergerichtliche
Rechtsprechung; prägnanter lässt sich kaum zeigen, dass
augenscheinlich die Normgeber selbst bereits den Überblick
verloren haben.
Und es erinnert fatal an den „absoluten Egalitarismus“, den Mao
Tse-tung predigte; vgl. Jung Chang und Jon Halliday: Mao, München
2005, S. 105
Hier liegt auch der Grund für das mehr und mehr ausufernde
Interesse aller Behörden an Informationen über Vorgänge
in der Welt. Die Überwachungsmaßnahmen des „big
brother“ sollen – möglichst in Echtzeit – Daten über die
Welt an die aus der Ferne entscheidenden Beamten vermitteln, damit
wenigstens eine irgend greifbare Chance auf angemessenes
öffentliches Handeln besteht. Weil aber jeder Eingriff durch
die Behörde diese Welt sogleich wieder verändert, gerät
das Zusammenspiel zwischen flexibler ziviler Welt und unflexiblerer
Behörde zu einem ununterbrochenen Wettlauf zwischen Hase und
Igel. Dieser Wettlauf beschleunigt sich in dem Maße, in dem
mehrere Behörden – zwangsläufig voneinander unabhängig
– in das Weltgeschehen steuernd eingreifen wollen. Zuletzt
blockieren die zur Koordinierung allen Behördenhandelns mehr
und mehr geschaffenen weiteren öffentlichen Stellen sich selbst
(und natürlich auch die bearbeitete, reale Welt selbst). Wir
finden also zuletzt geradezu eine bürokratische Variante der
Heisenberg’schen Unschärferelation.
In „Der zweite Weltkrieg“ – Kapitel „Triumph und Tragödie“
Das hier von mir gewählte, extreme Beispiel des Entscheidens
über fremder Leute Leben und Eigentum macht mein Thema zwar
sehr anschaulich, wie ich glaube. Dennoch sehe ich mich der Ordnung
halber wenigstens in dieser Fußnote zu einer ergänzenden
Bemerkung gehalten: Churchill stellte bei seinem Gespräch mit
Stalin klar, selbst ohne parlamentarische Vollmacht zu handeln und
seine Idee lediglich als Vorschlag zu verstehen, den ‚wir dann
den Polen vorlegen und zur Annahme empfehlen können’. Es
war also nicht so, dass Churchill über die Köpfe Polens
hinweg ‚menschliche Streichhölzer’ zu verschieben trachtete
(jedenfalls nicht über die Köpfe polnischer Politiker
hinweg…).
Umgekehrt erscheinen gerade die Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit vereinbarungsgestützter Kooperationen
als das ewige Verteidigungsmittel der übergangenen Massen.
Anders sind weder dezentrale „Korruption“ in ihrer stets
beseitigungsresistenten Beharrlichkeit, noch auch das kontinuierlich
beobachtbare Entstehen sogenannter „Schwarz“märkte
erklärlich.
Thorsten Kingreen: Verfassungsrechtliche Grenzen der
Rechtsetzungsbefugnis des gemeinsamen Bundesausschusses im
Gesundheitsrecht in: NJW 2006, 877 [879]. Die Interpretation alleine
dieses einen Satzes rechtfertigt im Grunde einen ganzen eigenen
Aufsatz; für den hiesigen Zusammenhang sei nur auf dies
hingewiesen: Dem gesamten Satz fehlt das Subjekt, denn offen bleibt,
wer (?) die Entscheidung akzeptiert. Auch das Hilfsverb „werden“
kann nicht befriedigen; denn gemeint ist greifbar nicht eine
deskriptive Beschreibung der (allgemeinen) Entscheidungsakzeptanz,
sondern die normative Erkenntnis, dass der jeweilige Adressat der
Entscheidung diese schlichtweg hinnehmen „muß“ (!).
Aber selbst mit diesen Konkretisierungen bleibt noch immer völlig
unentschieden, wie genau es um das „Anerkennen“ von
Regeln in jenem Satze steht und was unter ‚Sachadäquanz’
in diesem Sinne zu verstehen sein könnte. Konkret: Ob
derjenige, der eine – aus seiner Sicht – konsensunfähige
Entscheidung faktisch hinzunehmen hat, Trost in der Erkenntnis
findet, Opfer einer wenigstens sachadäquaten Regel geworden zu
sein? Und all dies auch noch auf dem ohnehin so schlüpfrigen
Boden der „sozialen Gerechtigkeit“, deren Unterschied zur
traditionell anerkannten Gerechtigkeit noch niemand hat umrisshaft
definieren können?
Anschaulich hierzu mit Beispielen: Hans Herbert von Arnim, Vom
schönen Schein der Demokratie, München, 2000, S. 260ff.
NJW 2005, 891 ff.; nach meinem Dafürhalten markiert diese
Entscheidung den Anfang vom grundgesetzlichen Ende des sogenannten
„solidarischen Gesundheitssystems“ mit Zwangsteilnahme.
Sobald das Bundesverfassungsgericht die Konsequenz finden wird,
seine dort aufgeworfenen Fragen an den Maßstäben
insbesondere auch des Art. 1 Abs. 1 GG zu messen, werden
medizinische Teilnahme- und Zuteilungszwänge im ökonomisch
denknotwendig stets begrenzten Leistungsspektrum argumentativ nicht
mehr zu halten sein.
In seinem lesenswerten Buch „Die ferne Haut“ (1. Aufl.,
Berlin, 1999) beschreibt Florian Felix Weyh am Beispiel der winzigen
und filigranen Bedienungseinheiten unserer High-Tech-Geräte,
warum Technik Menschenmaß haben muß: „Schlug sich
die Menschenverachtung des 19. Jahrhunderts [man muß wohl
ergänzen: und weiter Teile des 20.Jahhunderts] im
Gigantismus nieder, drückt sie sich im ausgehenden 20.
Jahrhundert in der Mikromanie aus. Technik muß Menschenmaß
haben, um nicht vom Hilfs- zum Repressionsinstrument zu werden.“
(a.a.O. S. 51). Bezeichnenderweise
übrigens weist Weyh a.a.O. S. 19 auch noch auf einen
verfassungsrechtlich fruchtbaren Gedanken hin: Die Würde des
Menschen sei „unantastbar, weil eben die Unantastbarkeit Würde
schafft“!
Alles Aufklären, Erforschen, Durchleuchten, Ermitteln, Steuern
und Lenken führt nie zum gewünschten Ergebnis. Man mag
elektronische Gesundheitskarten, Fahrtenbücher, Bilanzen,
Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten einführen ohne
Grenzen und Ende; das Leben vor Ort wird immer bunter sein, als
seine verwaltungstechnische Erfassung.
Aus diesen Gründen bleibt der stete Ruf nach
„Entbürokratisierung“ auch immer ungehört. Der Beamte
in seiner Behörde, der doch – mit dem reinsten Gewissen – nur
das Beste in seinem Zuständigkeitsbereich erreichen möchte,
kann alleine deswegen einer entbürokratisierenden Beschneidung
seiner Amtsbefugnisse nie zustimmen, weil er diese aus seinem
eigenen Horizont als Mittel zur Qualitätsreduktion seines
eigenen Handelns begreift. Genau das aber würde ihn selbst in
Frage stellen. Wäre er nicht so geschmacklos, böte sich
der Vergleich an, von einer Mutter mit Kinderwunsch eine
Selbststerilisation zu verlangen.
Ein promovierter, selbständiger Arzt sagte mir einmal, Verträge
abzuschließen sei ihm so unübersichtlich und unangenehm,
dass er sich – so wörtlich – einen „großen Bruder“
wünsche, der alles juristisch Verwaltungsrelevante für ihn
erledige. Ich antwortete ihm: „Verzichten Sie doch einfach auf Ihr
Leben und lassen Sie sich Ihre Zukunft ganz bequem abbuchen. Wer
nicht erwachsen sein will, muß Knebel und Fesseln ertragen.“
Hier liegt m. E. auch eine der Wurzeln der europäischen
Sozialdemokratie: Der Arbeiter sah, wie seines Fabrik funktionierte.
Er war begeistert und glaubte, eine ganze Gesellschaft müsse
auch so funktionieren können.
Das ist übrigens auch Kernthema von Karl Raimund Poppers Werk:
Das Elend des Historizismus. Er formuliert: „Eine
wissenschaftliche Theorie der geschichtlichen Entwicklung als
Grundlage historischer Prognosen ist unmöglich.“ (a.a.O.
[Vorwort zur englischen Ausgabe aus dem Juli 1957])
Christoph Auffarth weist in einem lesenswerten Buch über die
Ketzer [Die Ketzer, München 2005] darauf hin, dass die
‚Erfindung’ der Ketzer durch deren Definition seitens der
römisch-katholischen Kirche nicht inhaltlichen, sondern nur
pragmatischen Erwägungen folgte: „Diejenigen werden zu
Ketzern gemacht, die sich weigern, sich der Autorität der
römischen Kirche zu unterwerfen.“ [ibid.
S. 8f.]. Und – einmal etabliert – wurde diese kirchliche
Macht vehement verteidigt, unter kirchenrechtlichem Rückgriff
auf ein rund achthundert Jahre altes Gesetz: “Mit dem Gesetz
Quisquis von 391 hatten die römischen Kaiser … sich eine
geradezu heilige Unberührbarkeit zugelegt. Wer immer ihnen
bedrohlich werden könnte, … ‚verletzte die kaiserliche
Würde’, beging das crimen laesae maiestatis.“ [ibid. S.
73].
„Niedergangsszenarien und Krisenstimmung dominierten das
politische Klima Großbritanniens während der siebziger
Jahre…“ schreibt Dominik Geppert in: Thatchers konservative
Revolution, München 2002, S. 227
Ludwig von Mises, Nation, Staat und Wirtschaft, Wien 1919,
reproduzierte Ausgabe 2006, Colombo, S. 41f.
Merke: „Die Wirtschaftsgeschichte ist eine Entwicklung der
Arbeitsteilung. … Die Erkenntnis der Tatsache, dass die
arbeitsteilig verrichtete Arbeit produktiver ist, als die ohne
Arbeitsteilung verrichtete, macht der Isoliertheit der einzelnen
Wirtschaften ein Ende. Das Verkehrsprinzip, der Tausch, schlingt ein
Band um die einzelnen … Wirtschaft wird aus einer Sache des
Einzelnen eine gesellschaftliche Angelegenheit.“ (Mises
a.a. O. S. 150f.)
Roland Baader: Das Kapital am Pranger, Gräfelfing 2005, S. 38